In Uster hat das Baubüro in situ mit wiederverwendeten Containern und Bauteilen attraktive Räume für das Provisorium der Kantonsschule geschaffen. Sogar Betonplatten aus einem Tunnelbau fanden einen erneuten Einsatz, erläutert Benjamin Poignon im Gespräch mit der Modulart-Redaktorin Marion Elmer.

Provisorium der Kantonsschule Uster.
Bild: Martin Zeller
Die Container für das Provisorium der Kantonsschule Uster haben bereits ihren dritten Einsatz?
Benjamin Poignon (BP): Richtig. Begonnen hat die Geschichte allerdings ohne das Baubüro in situ. Die Container dienten zuerst für ein Provisorium der Berufsfachschule Uster. Danach kaufte der Kanton Zürich einen Drittel der Container und beauftragte uns damit, sie für das dreijährige Provisorium der Kantonsschule Lee nach Winterthur zu zügeln und aufzubauen. Als es darum ging, die Container erneut in Uster wiederzuverwenden, kam der Kanton erneut auf uns zu.
Was ist in Uster nun anders?
BP: Wir haben die Container sowie die Aussenraumgestaltung von Winterthur übernommen. Da das Provisorium für die Kantonsschule im Lee nur drei Jahre genutzt wurde, waren die bauphysikalischen Anforderungen viel geringer als nun in Uster. Hier werden die Container mindestens zehn Jahre stehen und mussten deshalb entsprechend ertüchtigt werden. Sie haben besser gedämmte Dächer, hinterlüftete Fassaden und eine vorangestellte Klimazone erhalten.
Wie entstand die Idee für diese Klimazonen?
BP: Die Container sind ja sehr funktionell und wurden telquel übernommen, nur der Boden ist neu. Deshalb wollten wir für die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen einen attraktiven Bonus schaffen. Da wir die Fassaden sowieso neu machen mussten, kam im Gespräch mit dem Bauphysiker die Idee auf, eine der vier Fassaden als Übergang zwischen innen und aussen zu gestalten. Der Vorbau dient nicht nur als Klimazone, er wird etwa auch für den Gruppenunterricht genutzt.
Wird es in den Containern im Sommer nicht sehr heiss?
BP: Das war eine unserer grössten Sorgen, weshalb wir verschiedene Massnahmen getroffen haben. Zum einen eben die Klimazone, die beim Kühlen und Entlüften, respektive im Winter beim Wärmen hilft. An den Aussenseiten der Vorbauten befinden sich Eckkamine. Über diese steigt die warme Luft und kühle kann nachfliessen. Vor einigen Fenstern sind fixe Gitter montiert, damit sie über Nacht offenbleiben und die Räume auskühlen können. Eine Dachbegrünung war wegen der Statik leider nicht möglich, stattdessen haben wir an den Fassaden Kletterhilfen für Pflanzen angebracht. Die Kletterpflanzen, die in der Sickergrube vor den Bauten wurzeln, sind schon im ersten Jahr bis nach ganz oben gewachsen.
Wenn ich die Bauteilkarte studiere, fällt mir auf, dass sehr viele Bauelemente nicht aus Winterthur stammen.
BP: Das ist richtig. Aus Winterthur haben wir die Container und die Erschliessung weitergenutzt. Alle zusätzlichen Fenster, Türen und Lampen stammen aus verschiedenen anderen Gebäuden. Der Boden im Erdgeschoss der Klimazone stammt aus einem Tunnelprovisorium in Walenstadt. Die Platte wurde mit Fasern statt mit Eisen armiert, ist deshalb noch besser instand, aber sehr schlecht recyclierbar. Deshalb hat Zirkular, unser Partnerunternehmen, mit den Tunnelbauern überlegt, wie sich die rund 2500 Platten weiternutzen lassen. Wir haben letztlich 50 davon verbaut.
Neu ist demnach nur das Holz für die Klimazonen?
BP: Nicht nur. Das Fundament und der Linoleumboden in den Containern sind neu, ebenso die Abdichtung auf dem Dach sowie die Fassadendämmung und -hinterlüftung. Wir hätten gerne eine bestehende Wärmepumpe eingebaut, aber die Bauherrschaft hatte Bedenken. Bei der Photovoltaik-Anlage gelang es fast, bestehende Module weiterzunutzen. Letztlich scheiterte es am Terminplan.
Wie funktioniert der Planungsprozess beim Re-Use-Bauen?
BP: Wenn man zu Projektbeginn noch kein sogenanntes Quellobjekt hat, muss man mit Hypothesen arbeiten. Wir haben beispielsweise für die Fassaden der Klimazonen ein Raster geplant, das sich auf verschiedene Art füllen lässt. Je mehr Glück man bei der Bauteilsuche hat, desto blauer wird der Raster. Hat man weniger Erfolg, gibt es mehr rote, neue Passstücke. In Uster hatten wir Glück: Wir konnten aus einer Wohnbausiedlung in Zürich zwei-, drei- und vierflügelige Balkonfenster übernehmen. Die vierflügeligen Fenster sind im Untergeschoss verbaut, die zweiflügeligen im Obergeschoss.
Woher stammen die farbigen Fassadenplatten?
BP: Sie stammen von einem Dach in Frick und zwei Fassaden in Wallisellen, beziehungsweise Rotkreuz. Mit den drei Farben vor Augen ist dann die Idee entstanden, die Fassade in Anlehnung an die Klimastreifen zu gestalten.
Damit ein Bauteil wiederverwendet werden kann, muss es qualitative Anforderungen erfüllen. Wie läuft dieser Prozess ab?
BP: Der Bauphysiker sagt, welche Anforderung ein Bauteil braucht, bei einem Fenster beispielsweise der U-Wert und der Schallschutz. Wenn Zirkular Fenster findet, fehlt vielleicht die Hälfte der Angaben. Dann muss nachrecherchiert werden. Wenn man weiss, aus welcher Zeit ein Bauteil stammt, kann man Annahmen darüber treffen, welche Anforderungen es erfüllt. Wenn die Nachrecherche nicht gelingt, müssen Messungen gemacht werde
Wann lohnt sich Re-Use, wann nicht?
BP: Es sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Eine grosse Frage ist immer wieder die Demontierbarkeit. Wenn man genug Zeit hat, lässt sich zwar alles demontieren. Aber das lohnt sich eher nur bei Bauteilen, die neu sehr teuer sind. Dämmelemente, die neu günstig zu haben sind, sind meistens so verklebt, dass es sich nicht lohnt. Bei verspachtelten Gipsplatten sieht man meist nicht mehr, wo die Schrauben sind, Re-Use wird da auch eher schwierig. Deshalb ist es auch so wichtig, das Design for Disassembly voranzubringen. Wenn wir neue Bauelemente einsetzen, achten wir darauf, dass sie demontierbar sind und beispielsweise Schrauben nicht zugespachtelt werden.
Noch machen Re-Use-Projekte einen Bruchteil aus. Verändert sich etwas in der Bauwirtschaft?
BP: Wir spüren den Willen von vielen Bauherren, alle Hebel zu bewegen, um nachhaltiger zu bauen. Wenn es konkret wird, hapert es noch bei der Umsetzung. Ist man bereit, mehr zu bezahlen oder auf etwas zu verzichten? Es braucht meiner Meinung nach auch einen Perspektivwechsel: die die Qualität des Gebrauchten sehen. Wenn man mit Re-Use baut, sind die Bauteile zwar gebraucht, aber qualitativ sehr gut. Man kann vielleicht einen Granitboden einbauen, der sonst nicht im Budget liegen würde.

Benjamin Poignon, Baubüro in situ.
Bild: Martin Zeller
Zur Person
Benjamin Poignon schloss 2014 ein Doppelstudium in Architektur und Bauingenieurwesen in Lyon ab (INSA-ENSA). In Paris spezialisierte er sich auf Zirkularbau und Wiederverwendung und eignete sich dabei Grundkenntnisse der Schreinerarbeit an. 2016 gründete Poignon die Werkstatt «Bricologis» bei Lyon. Seit 2018 ist er Mitarbeiter beim Baubüro in situ in Zürich und seit 2020 Mitglied im Vorstand vom Bauteilnetz Schweiz.
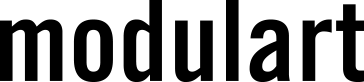




Schreiben Sie einen Kommentar
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.